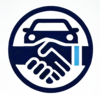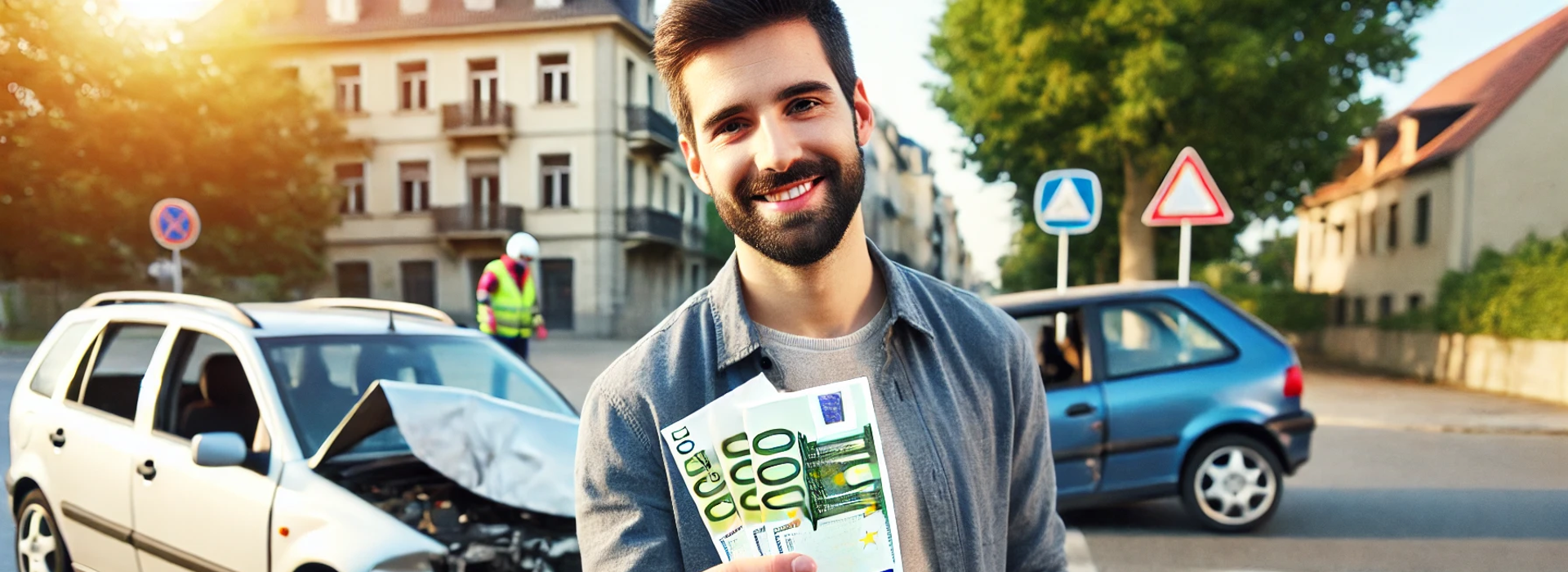Schadenersatzleistung ohne Nachweis der Reparatur – ganz legal
Bei einer fiktiven Abrechnung wird der Schadenersatz für die entstandenen Schäden von der Kfz-Haftpflichtversicherung des Unfallgegners bezahlt, ohne dass die Reparatur des Fahrzeugs nachgewiesen wird. Dieses Vorgehen ist vollkommen rechtens und wird in vielen Gerichtsurteilen bestätigt. Dies beruht auf der Überlegung, dass der (Wiederverkaufs-) Wert des Fahrzeugs durch den Schaden geringer geworden ist. Deshalb muss dem Eigentümer eine Entschädigung auch dann zustehen, wenn er der Schaden nicht repariert. Es steht es dem Eigentümer frei, das Fahrzeug mit den entstandenen Unfallschäden weiter zu benutzen oder auch die Schäden in Eigenleistung zu reparieren. Die fiktive Abrechnung lohnt sich daher besonders dann, wenn der Schaden kostengünstig privat repariert werden kann. Eine fiktive Abrechnung ist aber auch in der Weise möglich, dass ein Teil der Reparatur in einer Fachwerkstatt durchgeführt und der andere Teil in privater Leistung erbracht wird oder etwa in der Weise, dass von der Werkstatt nicht sämtliche empfohlenen Arbeitsschritte, die für einen vollwertigen Reparaturerfolg nicht erforderlich sind, durchgeführt werden. Dem Geschädigten steht es auch frei, den Schaden zuerst fiktiv abzurechnen und das Geld danach in eine Reparatur zu investieren (besondere Konditionen mit seiner Werkstatt zu vereinbaren).
Bei der nicht fiktiven Schadenregulierung reichen der Geschädigte oder seine Werkstatt nach erfolgter Reparatur die Reparaturrechnung bei der gegnerischen Versicherung ein. Entscheidet sich der Geschädigte für eine fiktive Abrechnung, reicht er ein Schadengutachten oder ein Kurzgutachten bei der Versicherung ein. Von den veranschlagten Reparaturkosten bringt die Versicherung die Umsatzsteuer in Abzug, solange der Anfall von Umsatzsteuer nicht nachgewiesen wurde. Die Sachverständigen- und Rechtsanwaltskosten werden bei Privatleuten demgegenüber mit Umsatzsteuer übernommen.
Von der Einholung eines Kostenvoranschlages anstelle eines Kurzgutachtens ist abzuraten. In der Praxis kürzen die Versicherungen die kalkulierten Reparaturkosten bei nahezu jedem Schadenfall. Solche Kürzungen fallen bei einem Kostenvoranschlag viel leichter als bei einem Expertengutachten. Ein Kostenvoranschlag enthält so gut wie nie eine (brauchbare) Fotodokumentation. Zudem wird in einem Kostenvoranschlag keine Wertminderung ausgewiesen.
Eine fiktive Abrechnung ist auch bei einem wirtschaftlichen Totalschaden möglich. Ein wirtschaftlicher Totalschaden liegt dann vor, wenn die Reparaturkosten zuzüglich des Restwertes des Fahrzeugs nach dem Unfall höher sind als der Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs vor dem Unfall. In solchen Fällen erhält der Geschädigte grundsätzlich nur den Wiederbeschaffungsaufwand (Wiederbeschaffungswert minus Restwert).
Ein Beispiel: Das Fahrzeug hatte vor dem Unfall einen Wiederbeschaffungswert von 6000 EUR und hat nach dem Unfall noch einen Restwert von 2000 EUR. Die Reparatur soll 4500 EUR brutto kosten. 2000 EUR Restwert + 4500 EUR Reparaturkosten ergeben 6500 EUR. Das sind 500 EUR mehr, als das Fahrzeug vor dem Unfall wert war. Deshalb handelt es sich um einen wirtschaftlichen Totalschaden und der zu leistende Schadenersatzbetrag ist grundsätzlich auf den Wiederbeschaffungsaufwand in Höhe von 4000 EUR (6000 EUR WBW – 2000 EUR Restwert) beschränkt. In Fällen wie dem Vorliegenden gestattet es die Rechtsprechung dem Geschädigten, gleichwohl die (höheren) Reparaturkosten (hier i.H.v. 4500 EUR) anzufordern, wenn diese 130 % des Wiederbeschaffungsaufwands (hier: 4000 EUR x 130 % = 5200 EUR < 4500 EUR) nicht übersteigen und wenn der Geschädigte nachweist, dass er sein Fahrzeug in einen verkehrssicheren Zustand versetzt und noch weitere 6 Monate genutzt hat. Ein echter Totalschaden liegt demgegenüber dann vor, wenn die Reparaturkosten den Wiederbeschaffungsaufwand um mehr als 130 % übersteigen. In diesen Fällen ist der Geschädigte auf den Wiederbeschaffungsaufwand beschränkt. Eine fiktive Abrechnung der (höheren) Reparaturkosten ist in diesem Fall nicht möglich.
Auch die Nutzungsausfallentschädigung kann fiktiv abgerechnet werden. Dazu muss der Geschädigte die Reparatur des Unfallfahrzeugs nachweisen. Hat er in Eigenleistung repariert, richtet sich die Höhe der Nutzungsausfallentschädigung danach, wie schnell das Fahrzeug objektiv repariert werden konnte. Dazu greifen die Gerichte regelmäßig auf die entsprechende Angabe in einem Sachverständigengutachten zurück.
Die Stundensätze einer markengebundenen Werkstatt erhält der Geschädigte nur, wenn das Auto jünger als drei Jahre ist oder wenn sämtliche Inspektionen in einer markengebundenen Fachwerkstatt durchgeführt wurden.